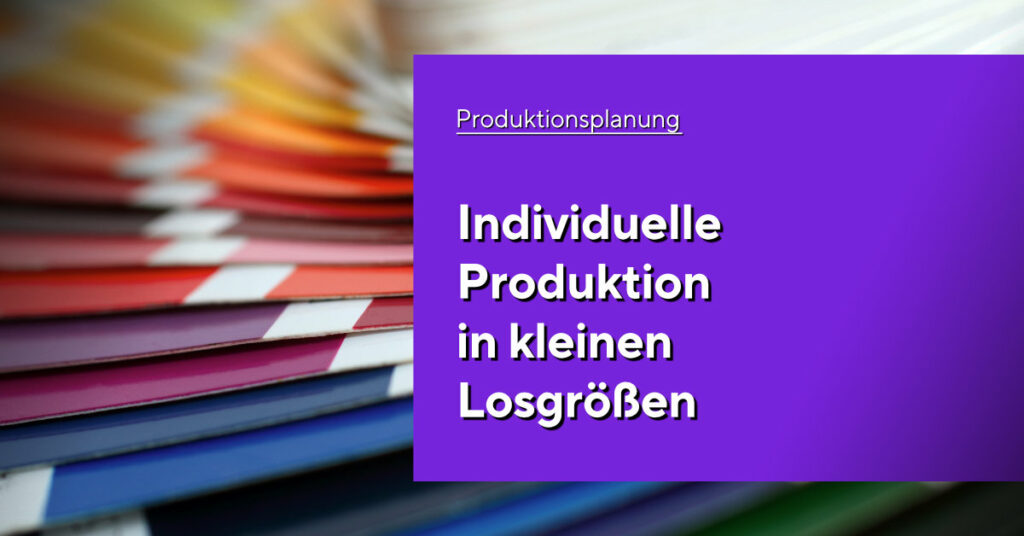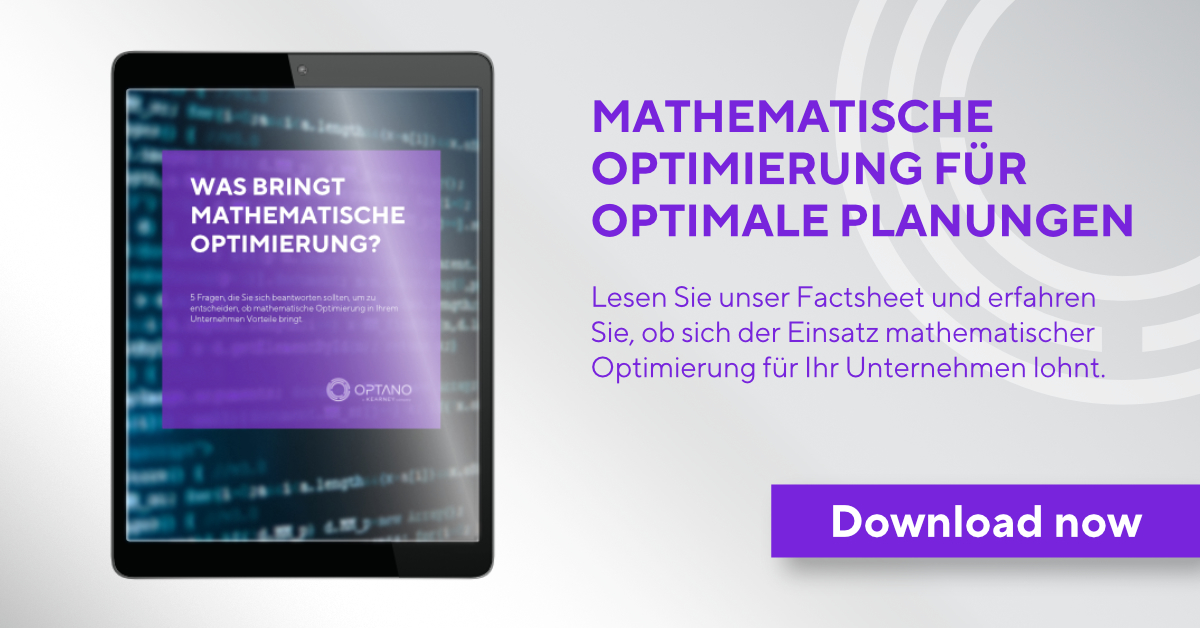Produktions-
planung im Takt
Wer schon einmal versucht hat, eine Produktionslinie bei schwankender Nachfrage stabil zu halten, weiß: Das ist leichter gesagt als getan. Die Realität in vielen Fertigungsbetrieben sieht so aus, dass Planer täglich zwischen Effizienz und Flexibilität jonglieren müssen. Lange Produktionsläufe helfen, Rüstkosten zu senken – aber sie führen zu übervollen Lagern. Kurze Zyklen ermöglichen schnelle Reaktionen auf den Markt, verursachen aber häufige Umrüstungen und Chaos im Ablauf.
Genau hier setzt ein Ansatz an, den OPTANO in den letzten Jahren gemeinsam mit Kunden weiterentwickelt hat: Rhythm Wheel basierte Produktionsplanung. Es geht darum, die Produktion in einen wiederkehrenden Rhythmus zu bringen – und damit Ruhe, Struktur und Effizienz in ein System zu bringen, das sonst oft von Ad-hoc-Entscheidungen geprägt ist.
Die Realität in der Produktionsplanung
In vielen Unternehmen – insbesondere in der Konsumgüterindustrie – wird die Produktionsplanung noch immer stark durch Meldebestände (Reorder Points) gesteuert. Das Prinzip ist einfach: Wenn der Bestand eines Produkts unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, wird nachproduziert. Was in der Theorie sinnvoll klingt, führt in der Praxis oft zu Problemen:
- Überbestände: Sicherheits- und Zyklusbestände werden vorsorglich aufgebaut, was Kapital bindet und Lagerkosten erhöht.
- Instabile Produktionspläne: Häufige Änderungen im Produktionsprogramm führen zu Stress bei Planern und Ausführenden.
- Hohe Rüstkosten: Jeder Produktwechsel bedeutet Aufwand – sei es durch Personalzeit, Materialverlust oder Maschinenstillstand.
- Reservekapazität: Um kurzfristige Nachfrageschwankungen zu bewältigen, planen viele Unternehmen mit zusätzlichen Schichten, die in einer bestimmten Woche möglicherweise benötigt werden – oder auch nicht.
Mit zunehmender Produktvielfalt und wachsender Komplexität verschärfen sich diese Herausforderungen. Die klassische Planung stößt an ihre Grenzen – und das nicht nur in Spitzenzeiten.
Was bedeutet Rhythm Wheel basierte Produktionsplanung?
Der Grundgedanke ist einfach: Statt täglich neu zu entscheiden, was produziert wird, wird ein wiederholendes Produktionsmuster definiert – ein sogenanntes „Rhythm Wheel“. Dieses legt fest, in welcher Woche welches Produkt in welcher Sequenz produziert wird. Das Volumen wird in der eigentlichen Produktionswoche basierend auf dem aktuellen Lagerbestand und der neusten Nachfrageprognose festgelegt. Typischerweise umfasst ein Zyklus 8 bis 20 Wochen und wird auf die spezifischen Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten.
Das klingt zunächst starr – ist aber in der Praxis erstaunlich flexibel. Der Planer kann in jeder Woche immer noch zusätzliche Produkte einplanen, wenn der nächste geplante Produktionstermin zu weit in der Zukunft liegt. Diese sollten zu einer möglichst geringen Störung der Abläufe führen. Dazu sollte das Produkt zum Beispiel nach einem anderen Produkt mit den gleichen Komponenten oder Verpackungsmaterial eingeplant werden. Denn der Rhythmus basiert auf einem digitalen Zwilling der Produktion, in dem verschiedene Szenarien durchgerechnet werden. So lassen sich Lagerbestände, Produktionsraten, Rüstzeiten und Kapazitäten simultan optimieren.
Wann lohnt sich Rhythm Wheel basierte Produktionsplanung?
Der Ansatz eignet sich besonders für Unternehmen mit make-to-stock-Strategien, also wenn Produkte auf Vorrat produziert werden und eine gewisse Planbarkeit der Nachfrage besteht. Besonders effektiv ist er, wenn:
- Mehr als acht Produkte auf einer Produktionslinie gefertigt werden.
- Die Produktionsumgebung durch häufige und unterschiedliche Umrüstungen geprägt ist.
- Die Nachfrage volatil, aber nicht vollständig unvorhersehbar ist.
- Die Produktionsplanung regelmäßig durch manuelle Eingriffe gestört wird.
- Die Organisation sehr hohe Lagerbestände hat, um Servicelevel-Ziele einzuhalten.
In solchen Fällen kann ein zyklischer Produktionsansatz helfen, die Komplexität zu reduzieren, die Abläufe zu stabilisieren und gleichzeitig die operative Effizienz zu steigern – ohne die Flexibilität vollständig aufzugeben.
Was bringt das konkret? Ein Blick in die Praxis
Ein führendes Konsumgüterunternehmen in Europa stand vor der Herausforderung instabiler Produktionszeiten, steigender Lagerbestände und ineffizienter Abläufe. Die Planung erfolgte bislang über klassische Reorder Points, was zwar die Lieferfähigkeit sicherstellte, aber zu hohen Sicherheitsbeständen und unregelmäßigen Produktionszeiten führte.
In einem Pilotprojekt wurden fünf repräsentative Produktionslinien in drei Ländern auf einen rhythmusbasierten Planungsansatz umgestellt. Dabei wurde ein optimiertes Rhythm Wheel definiert, das sowohl die Nachfrageprognosen und Servicelevel-Ziele, als auch die Umrüstkosten und Lagerhaltungskosten berücksichtigte.
Die Ergebnisse im Überblick:
- 10–15 % Reduktion der Lagerbestände: Durch die optimierte Zykluslänge konnten Sicherheits- und Zyklusbestände deutlich gesenkt werden.
- 1–2 eingesparte Schichten pro Linie: Die stabile Produktionsstrategie ermöglichte eine bessere Auslastung und reduzierte den Bedarf an Zusatzschichten.
- 5–10 % Senkung der operativen Kosten: Weniger ungeplante Wechsel, stabilere Abläufe und effizienterer Personaleinsatz führten zu spürbaren Einsparungen für Lagerhaltung, Umrüstungen und Personal.
Diese Verbesserungen wurden ohne zusätzliche Ressourcen im Tagesgeschäft erzielt. Die Ergebnisse des Piloten bildeten die Grundlage für einen unternehmensweiten Roll-out, der in mehreren Werken erfolgreich umgesetzt wurde.
Was macht den Unterschied?
Was sich in der Praxis immer wieder zeigt: Der Wunsch nach Stabilität ist groß. Nicht, weil Flexibilität unerwünscht wäre – sondern weil sie gezielt und kontrolliert eingesetzt werden muss. Ein klarer Rhythmus in der Produktion schafft genau das: Er gibt Orientierung, reduziert Ad-hoc-Entscheidungen und ermöglicht es, Ausnahmen bewusst zu planen.
Ein weiterer Punkt ist die Transparenz. Durch die Simulation verschiedener Szenarien im digitalen Zwilling können Planer besser abschätzen, welche Auswirkungen eine Änderung im Produktmix oder eine neue Nachfrageprognose hat. Somit können dem Vertrieb und der Geschäftsführung die dadurch entstehenden operativen Kosten direkt transparent gemacht werden.
Weitere interessante Beiträge
Was-wäre-wenn statt Was-jetzt?
Ein großer Vorteil des rhythmusbasierten Ansatzes liegt in der Möglichkeit, strategische Entscheidungen zu treffen. Statt nur auf aktuelle Bedarfe zu reagieren, können Unternehmen Szenarien durchspielen: Was passiert, wenn ein neues Produkt eingeführt wird? Wie wirkt sich eine Änderung im Servicegrad auf die Produktionskosten aus? Welche Auswirkungen hat eine Investition in zusätzliche Kapazitäten?
Diese Fragen lassen sich mit klassischen Planungssystemen oft nur schwer ganzheitlich beantworten. Der digitale Zwilling kann die Implikationen des unter den neuen Umständen optimierten Plans direkt quantifizieren.
Integration in bestehende Systeme
Ein häufiges Argument gegen neue Planungsansätze ist die Sorge vor aufwendiger Integration. Hier kann Entwarnung gegeben werden: Der rhythmusbasierte Ansatz lässt sich als intelligente Entscheidungsschicht auf bestehende ERP-, APS- oder MES-Systeme aufsetzen. Die vorhandene IT-Infrastruktur bleibt erhalten, und die Benutzer arbeiten in ihrer gewohnten Umgebung. Sollte sich das Unternehmen gerade in der Einführung eines solchen Systems befinden, kann der rhythmusbasierte Ansatz diese mit sofortigen Cash-Auswirkungen unterstützen.e Integration erfolgt über standardisierte Schnittstellen, und erste Prototypen sind oft schon nach wenigen Tagen einsatzbereit. Auch die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet – Planer können Szenarien direkt über Dashboards einstellen und vergleichen.
Rhythmus bringt Ruhe in die Produktion
Rhythm Wheel basierte Produktionsplanung ist mehr als nur ein neuer Planungsansatz – es ist ein strategischer Hebel zur Verbesserung von Effizienz, Resilienz und Transparenz in der Fertigung. Unternehmen, die auf zyklisches Scheduling setzen, profitieren von stabileren Abläufen, geringeren Kosten und einer besseren Synchronisation zwischen Produktion und Supply Chain.
In einer Zeit, in der Flexibilität und Effizienz gleichermaßen gefragt sind, bietet dieser Ansatz einen erprobten Weg, beides unter einen Hut zu bringen. Die Ergebnisse aus realen Projekten zeigen: zweistellige prozentuale Einsparungen bei Lagerbeständen und Betriebskosten sind keine Ausnahme, sondern die Regel.
Kontaktieren Sie uns einfach!
Wir stehen Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung! Kontaktieren Sie Denise Lelle gerne direkt. Sie ist telefonisch, per E-Mail oder auf LinkedIn erreichbar. Wir freuen uns auf den Austausch!